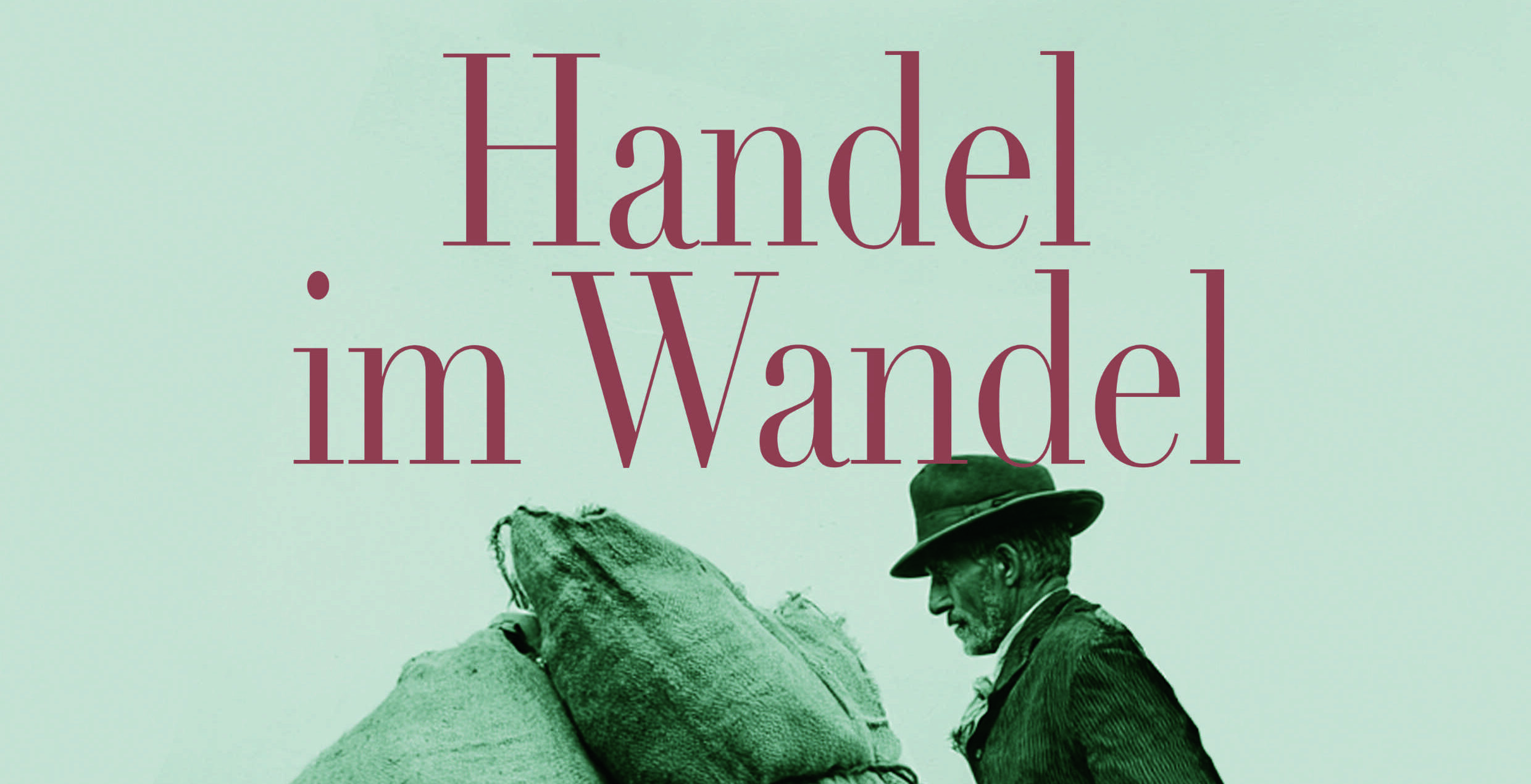
Von Tetenbüll in die Welt, vom kolonialen Handel bis zu Fair Trade – die Geschichte des Handels auf Eiderstedt, beleuchtet aus der Sicht eines kleinen Kaufmannsladens in Tetenbüll. Ausstellung vom 18.10.25 – 15.3.26
Kolonialwarenläden

Tee und Kaffee, Schokolade und Tabak, exotische Gewürze und Zucker haben die Lebensgewohnheiten in Europa völlig verändert. Ihre Bedeutung, die sie für unsere heutige Gesellschaft haben, ist nicht zu lösen von der Geschichte ihrer kolonialen Herkunft. Die Gewinne, die sie versprachen, ermöglichten es vielen Kaufleuten im 18. Jh. eigenständige Existenzen zu gründen. Anfang 1800 war der Handel schon weitgehend globalisiert und Waren, die von Übersee nach Deutschland kamen, waren nicht notwendigerweise ausschließlich aus deutschen Kolonien.
Der Kaufmann vor Ort war im 19. Jh. oft sowohl Einzel- als auch Großhändler, da er seine Waren einerseits direkt an die Endkunden abgab, als auch für kleinere Läden in der Nähe als Zwischenhändler diente. Es ist anzunehmen, dass sich die Endverbraucher auf dem Land wenig Gedanken um die Herkunft der Waren und die Umstände ihrer Herstellung gemacht haben. Es zählten eher das Prestige und ob man sich teure Gewürze oder Kaffee leisten konnte.
Anfang des 20. Jh. ging es den Kolonialwarenhändlern finanziell immer schlechter, da sie als Einzelhändler Konkurrenz von neuen Konsumgenossenschaften, wie „Kaiser‘s Kaffeegeschäft“, bekamen. Darauf hatten die alteingesessenen Kolonialwaren-Einzelhändler kaum eine wirtschaftliche Antwort. Nach einigen gescheiterten Anläufen schlossen sie sich 1907 zur „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“, der EDEKA, zusammen.
Kolonialismus
Die Entdeckung und Eroberung der Welt jenseits der Ozeane von Europa aus, begann im Mittelalter – nicht erst mit der Fahrt des Kolumbus 1492. Einerseits Entdeckerlust, aber vor allem auch die Aussicht auf Gold und Reichtum trieben zunächst Portugiesen und Spanier an. Schon hier gab es Verteilungskämpfe, die 1494 im Vertrag von Tordesillas mündeten, in dem sich Portugal und Spanien die Welt – auch die noch zu entdeckende – teilen wollten.
Nachdem vor allem in Amerika die indigene Bevölkerung durch unmenschliche Arbeitsbedingungen auf den Plantagen der Kolonialherren und eingeschleppte Krankheiten stark dezimiert war, begann man Menschen in Afrika zu versklaven und nach Amerika zu verschiffen. Schon dieser „Handel“ brachte den europäischen und arabischen Sklavenhändlern große Gewinne, danach profitieren die meist europäischen Plantagenbesitzer auf der ganzen Welt von den „billigen“ Arbeitskräften. Dass die verschleppten und versklavten Menschen weder angemessen entlohnt noch gut behandelt wurden, verteidigte man im Folgenden gerne mit religiösen und rassistischen Argumenten: Heiden seien im Vergleich zu Christen nichts wert oder die dunkle Hautfarbe zeige die Unterlegenheit der „Rasse“.
Innerhalb von 300 Jahren wurden so mehr als 10 Millionen Afrikaner nach Amerika deportiert, wo sie vor allem auf Baumwoll- oder Zuckerrohrplantagen arbeiten mussten. Die Portugiesen konzentrierten sich auf den Gewürzhandel und kontrollierten diesen mit ihren vielen kleineren Kolonien in der ganzen Welt über lange Zeit. Bis 1885 waren sämtliche Küsten Afrikas sowie des gesamten indo-ozeanischen Raumes inklusive Australien durch die Europäer kolonialisiert. Bis 1914 dann auch fast das gesamte afrikanische Binnenland. Die Europäer spielten ihren technologischen Fortschritt gnadenlos aus und rechtfertigten ihre Raubzüge durch die Welt mit Religion und Rassenlehre.
Die Bevölkerung in Europa profitierte in vielerlei Hinsicht von der Ausbeutung der kolonialen Gebiete. Händler, Reeder, Banken verdienten direkt an dem globalen Warenhandel, die Erweiterung des Warenangebotes eröffnete die Möglichkeiten der Kolonialwarenläden vor Ort und die Endverbraucher kamen in den Genuss von neuen Lebensmitteln und Luxuswaren, die durch die Ausbeutung in den Kolonien sogar für eine breite Öffentlichkeit erschwinglich waren. Dabei waren diese Hintergründe vielen Menschen vermutlich nicht bewusst, bzw. sie passten in ihr koloniales Weltbild und wurden nicht in Frage gestellt.
Die klassische Kolonialisierung ist bis heute weitgehend zurückgegangen. Die Muster und Verhaltensweisen des Kolonialismus finden sich aber in den aktuellen globalen Strukturen weiterhin wieder. Ausbeutung, Kinderarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen auf der einen Seite und hohe Gewinne, Überkonsum und Luxus auf der anderen Seite. Das betrifft auch heute noch sehr viele Warenbereiche: Gold und Diamanten genauso wie seltene Erden, Elfenbein und Baumwolle, Zucker, Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze, Öl etc.
Auch wenn der Turbokapitalismus nun Menschen auf der ganzen Welt ausbeutet, betrifft es doch vor allem die Arbeiter:innen im globalen Süden, die sich von den gezahlten Löhnen oft nicht einmal das Nötigste zum Leben leisten können.
Von Kolonialwaren zu fairem Handel

Anfang der 70er Jahre wurden in Deutschland die ersten Weltläden gegründet, wenig später entstanden die ersten Fair-Händler, wie GEPA, El Puente oder Globo. Heute gibt es über 100 vom Weltladen-Dachverband anerkannte Lieferanten und über 900 Weltläden. Und mehr als 10.000 Produkte. Ende der 80er Jahre litten Kaffeekleinbauern unter einem drastischen Preisverfall. Damit mehr Kleinbauern vom fairen Handel profitieren konnten, sollte der Absatz über den konventionellen Markt ausgeweitet werden: die Geburtsstunde des Fairtrade-Siegels. Seit 1992 macht es fair gehandelte Produkte außerhalb des Weltladens erkennbar und ermöglicht konventionellen Unternehmen den Einstieg in den fairen Handel mit einzelnen Produkten.
Kolonialwaren (Import)
Kaffee aus Afrika oder Südamerika, Tee aus Indien und China, Kakao, Zucker und Rum aus der Karibik und Gewürze, vor allem aus den tropischen Gebieten Süd-Ost-Asiens, sind nur einige der Waren, die als Kolonialwaren bezeichnet wurden. Bevor es sie gab, trank man Kräutertee, süßte sparsamst mit Honig und würzte mit Kräutern aus den heimischen Gärten und Wäldern. Nachdem die Kolonialwaren ihren Weg zu uns gefunden hatten, wurden sie schnell modern und alle wollten sie haben. Ein lukratives Geschäft, das auf der Ausbeutung von vielen Menschen beruhte.
Viele dieser Kolonialwaren stellen wir in Wort und Bild und mit einigem Anschauungsmaterial in der Ausstellung dar.
Export
Die Eiderstedter Marschlandschaft eignet sich besonders gut für die Viehwirtschaft. Exportschlager waren daher seit jeher tierische Produkte, wie Felle, Hörner oder Käse. Später kam der Handel mit lebenden Rindern dazu. Besonders der Export nach England nahm ungewöhnliche Ausmaße an. Käse war lange Zeit ein die vorherrschende Exportware, es wurden im Jahr 1610 beispielsweise über 3 Millionen Pfund Käse auf der Tönninger Waage für den Export abgewogen. Er ging nach Deutschland, Holland, England, aber auch in den Ostseeraum.
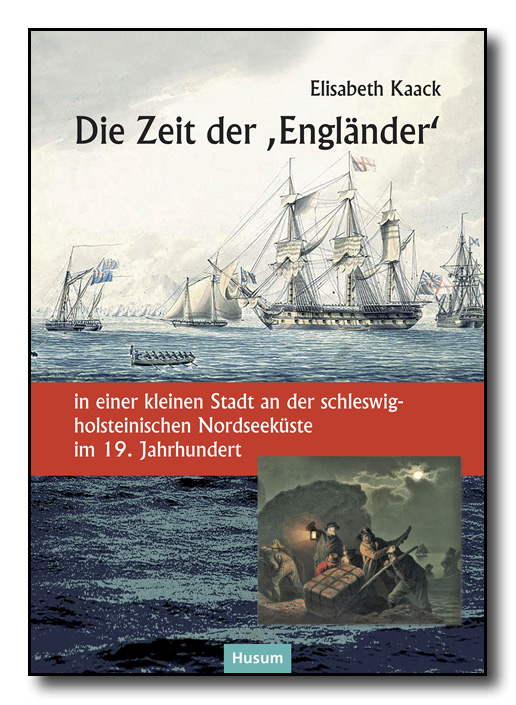
Rinder wurden ab 1842 in großen Mengen nach England verschifft, um den dortigen Bedarf an Fleisch für die Industriearbeiter zu decken. Durchschnittlich ca. 30.000 Rinder und über 40.000 Schafe wurden in der Zeit von 1846 bis 1888 pro Jahr (!) von Tönning (und Husum) nach England ausgeführt. Der Spitzenwert lag bei 49.440 Rindern im Jahre 1876.
Über diese Ereignisse und die Zeit der Engländer in Tönning informiert ein interessantes Buch der Stadtarchivarin von Tönning, Elisabeth Kaack.
Lüsterkeramik

Die Lüsterkeramik entstand im England des frühen 19. Jh. Sie war ein beliebtes Mitbringsel der Seeleute. Mit einem gebrannten Tongefäß als Grundlage wurden metallische Glasuren und farbige Dekore aufgebracht. Die Gefäße waren dann dem Anschein nach aus Silber, Gold oder Kupfer, jedoch viel preiswerter. Sie waren eine Zeit lang modern, verschwanden dann jedoch so gut wie vollständig von der Bildfläche.
Handelswege
Bootfahrten, Eisenbahnen und der Seehandel ermöglichten den Warentransport nach und von Eiderstedt. Das Tor zur Welt war hierbei Tönning, das über lange Zeit eine bedeutende Hafenstadt an der Nordseeküste war.
Anfang 1600 wurden die Norder- und die Süderbootfahrt sowie der Hafen von Tönning mit Hilfe der Holländer gebaut. Dies war die Grundlage für Warentransport und Handel auf Eiderstedt.
Der Hafen von Tönning war Dreh- und Angelpunkt für den Seehandel. Es gab den küstennahen Transport mit Plattbodenschiffen, den Handel mit England und vielen europäischen Häfen mit Segelschiffen, Dampfseglern und Dampfschiffen und ein paar wenige Verbindungen bis nach Australien mit großen Segelschiffen, die kaum in die Eider passten.
1854 kam die Eisenbahnverbindung von Flensburg nach Tönning dazu und erste Straßen auf Eiderstdt wurden befestigt, z. B. die Verbindung von Tönning nach Garding. Erst 1892 wurde die Eisenbahn nach Garding weitergebaut und 1932 bis nach St. Peter-Ording verlängert.
Zur wechselvollen Geschichte von Tönning empfehlen wir einen Besuch im Stadtmuseum im Packhaus Tönning und weitere Informationen über die Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte.
Zur Ausstellung gibt es einen Katalog mit vielen weiteren Informationen, der nur über das Haus Peters bezogen werden kann (solange der Vorrat reicht)

